Basisqualifikation
Die Basisqualifikation
Die Aufgabe des Juristen als Juristen ist es, Antworten auf Rechtsfragen zu geben. Die Fragen sind in der Regel mit Fällen (tatsächlich geschehenen oder erdachten Sachverhalten) verbunden. Die Antwort ist - aus der Perspektive des Richters betrachtet - die Entscheidung des Falles. Diese Entscheidung soll nicht willkürlich erfolgen und auch nicht ausgewürfelt werden, sondern dem Recht entsprechen. Das Recht stellt (in Gesetzen, Verordnungen, Satzungen, Gerichtsentscheidungen) Normen bereit, die nur dann eine (positive) Antwort auf die gestellte Frage ermöglichen, wenn erstens eine Rechtsfolge nachgefragt wird, die die Rechtsordnung kennt, und zweitens der Sachverhalt die Voraussetzungen erfüllt, an die die Rechtsordnung das Eintreten der Rechtsfolge knüpft. Die erste Bedingung löst die Suche nach einer geeigneten Rechtsgrundlage (Rechtsnorm) aus, die zweite führt zum Vergleich des Sachverhalts mit den in der Rechtsnorm angeführten Voraussetzungen, mit dem Tatbestand der Rechtsnorm. Diesen Vorgang nennen die Juristen Subsumtion.
Die Grundelemente in der Falllösungsarbeit des Juristen sind: der Sachverhalt (Fall), die auf eine Rechtsfolge abzielende Fallfrage (Antrag) und eine Rechtsnorm mit Tatbestand und Rechtsfolge.
Diese sind in einer bestimmten Weise einander zugeordnet.
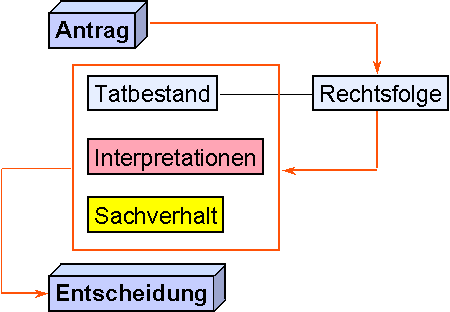
Der Antrag zielt auf die Rechtsfolge, der Sachverhalt auf den Tatbestand. Die Entscheidung gibt eine Antwort auf den Antrag. Neu ist in unserem Bild das Element der Interpretation. "Alles ist Auslegungssache", weiß schon ein Laie über das Tun der Juristen zu berichten, und in der Tat, ob ein Sachverhalt unter den Tatbestand eines Gesetzes "passt", zeigt sich in der Regel erst nach einer Auslegung des in abstrakter Sprache gehaltenen, für eine Vielzahl von Fällen geschaffenen Tatbestands der Rechtsnorm mit Blick auf den in lebensnaher und konkreter Sprache beschriebenen Sachverhalt. Das den Tatbestand der Rechtsnorm mit dem Lebenssachverhalt verbindende Element ist die Auslegung oder Interpretation.
Schwierigkeiten, dieses Phänomen einzuordnen, haben diejenigen, die die Rechtsanwendung logisch auf ein Dreiermodell mit Obersatz (Rechtsnorm), Untersatz (Fall) und Schlusssatz (Entscheidung) reduzieren. Das machen leider die meisten Juristen und Rechtslehrer (gerade auch in den zur Einführung bestimmten Lehr- und Lernbüchern). Wer nur für drei Sätze mit zwei Prämissen Platz hat, muss bei mehr als drei Sätzen oder mehr als zwei Prämisseb etwas fallen lassen. Das ist dann in der Regel die konkrete Sachverhaltsbeschreibung. Zum Untersatz wird das Ergebnis der Subsumtion, dass nämlich ein Fall des Tatbestands gegeben sei. Dazu heißt es dann (im falschen Bilde zutreffend), dass die schwierigste Aufgabe des Juristen darin liege, den Untersatz zuzubereiten.
Das Dreiermodell entspricht dem Stand der Logik vor mehr als 2.000 Jahren (Syllogistik des Aristoteles). Die moderne Logik erlaubt uns Ableitungen über vielzählige Prämissen und damit ein der juristischen Entscheidung angemessenes Vierermodell. Die Entscheidung bleibt der Schlusssatz der Ableitung. Prämissen sind der Sachverhalt, die Rechtsnorm und die Interpretationen, die die Tatbestandsvoraussetzungen der Rechtsnorm so mit den Beschreibungen des Sachverhalts verbinden, dass sich die Entscheidung nach den Regeln der Logik erschließen lässt. Diesem Modell ist die obige Grafik nachgebildet.
Die Gutachtentechnik
Die Gutachtentechnik orientiert sich an dem methodischen Grundgerüst. Sie trägt der Tatsache Rechnung, dass regelmäßig nicht nur eine Norm zur Entscheidung der Fallfrage heranzuziehen ist, sondern deren viele. Dabei versucht sie, den Weg durch das Normendickicht zu steuern und so etwas wie denkökonomische Minima der gutachtlichen Fallentwicklung zu formulieren.
Das Gutachten ist alsdann eine Darstellungsform für die Entwicklung einer Falllösung von der Ausgangsfrage zum Ergebnis. Die im folgenden beschriebenen "denkökonomischen Minima" sollen einerseits davor bewahren, Zeit, Gedanken und Energie auf überflüssige Erörterungen zu verschwenden, und andererseits dazu beitragen, alle erforderlichen Erörterungen aufzugreifen. Für die Erreichung des letzteren Ziels sind sie allerdings nur notwendige, nicht auch hinreichende Bedingungen.
Erste Aufgabe einer gutachtlichen Fallentwicklung ist die Herausarbeitung der Ausgangsfrage. Im Zivilrecht geht es dabei in der Regel um die Feststellung eines tatsächlichen Begehrens. Die Frage lautet dann: "Wer will was von wem?" Die Antwort darauf ist notwendiger Einleitungssatz einer jeden gutachtlichen Fallentwicklung. Sind alternative Antworten möglich, so ist für jede Alternative eine eigene gutachtliche Entwicklung erforderlich.
Auf die Feststellung des tatsächlichen Begehrens folgt die hypothetische Einführung einer dem tatsächlichen Begehren korrespondierenden Rechtsnorm (Anspruchsgrundlage). Stellt man sich Normen in einer Wenn-dann-Verknüpfung von Tatbestand (= Anspruchsvoraussetzungen) und Rechtsfolge vor, so sind nur jene Normen geeignete Anspruchsnormen, deren Rechtsfolge dem tatsächlichen Begehren entspricht.
Im dritten Schritt ist das Vorliegen der Tatbestandsmerkmale der hypothetisch eingeführten (und gegebenenfalls als geltend begründeten) Anspruchsnorm zu untersuchen. Dabei geht es um die Frage, ob der Sachverhalt die Merkmale aufweist, welche durch die Bedeutungsregeln (Auslegungshypothesen) ausgezeichnet werden, die den Gehalt des Tatbestands der Anspruchsnorm ausmachen. Die Bedeutungsregeln können durch andere Normen wenigstens teilweise festgelegt sein (so z.B. das "Eigentum" in § 823 Abs. 1 BGB durch die Vorschriften des Sachenrechts). Dann müssen die entsprechenden Normen eingeführt und untersucht werden. Die Bedeutungsregeln können auch Entscheidungsspielräume lassen. Diese sind unter Erörterung der verschiedenen Ausfüllungsmöglichkeiten durch Festsetzung auszufüllen.
Die Untersuchung der Tatbestandsmerkmale der hypothetisch eingeführten Anspruchsnorm kann zu zwei Ergebnissen führen. Entweder wird der Tatbestand verneint. Dann steht fest, dass das Begehren durch die untersuchte Norm jedenfalls nicht begründet werden kann. Man hat dann eine andere (dem tatsächlichen Begehren korrespondierende) Anspruchsnorm ein- und die Untersuchungen zu deren Tatbestand durchzuführen. Oder aber der Tatbestand wird bejaht. Dann stellt sich die Frage nach möglichen Einwänden (Gegenrechten), die den Anspruch trotz Vorliegen des Tatbestands der Anspruchsnorm zu Fall bringen können.
Die mögliche Einwände begründenden Gegenrechtsnormen sind ebenso hypothetisch einzuführen wie die dem Begehren korrespondierenden Anspruchsnormen. Es muss sich um Normen handeln, die von ihrer Rechtsfolgenseite her überhaupt geeignet sind, den bis dahin begründeten Anspruch zu Fall zu bringen. Nur im Hinblick auf sie gebietet die Denkökonomie eine Untersuchung der Tatbestandsmerkmale. Werden die Voraussetzungen der Gegenrechtsnorm bejaht, sind, wenn nicht eine Gegengegenrechtsnorm eingreift, die Erörterungen zur geprüften Anspruchsgrundlage abzuschließen und eine neue Anspruchsgrundlage ist gegebenenfalls einzuführen. Werden die Voraussetzungen aller potentiellen Gegenrechtsnormen verneint, so ist das Begehren nach der untersuchten Anspruchsgrundlage begründet.
Die Rede von Anspruchsnormen und Gegenrechtsnormen führt uns zu einer Einteilung der rechtlich relevanten Normen nach der Beweislast.
Eine ausführlichere Darstellung der Grundregeln der gutachtlichen Fallentwicklung findet man in dem Lernmodul Logik und Rechtsanwendung.
